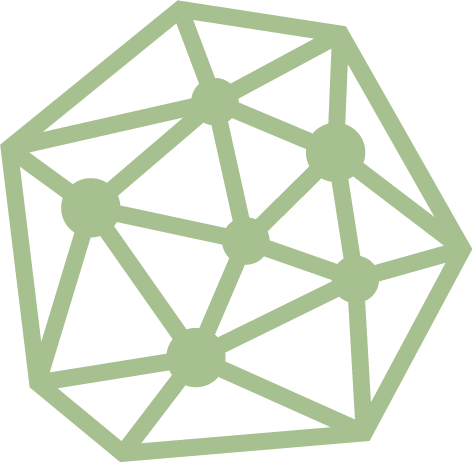Forderungskatalog
Die Bundesfachschaft Landschaft (BuFaLa) hat als studentische Vertretung aller Landschaftsstudierenden des deutschsprachigen Raumes Forderungen formuliert. Diese sind untergliedert in hochschulpolitische, fachbezogene und berufsständische Forderungen.
Die Idee für eine Positionierung entstand auf der Studierendenkonferenz Landschaft (LASKO) in Wien 2022 und wurde in den Folgejahren während ständiger inhaltlicher Debatte verschriftlicht. Eine erste Fassung dieses Kataloges wurde auf der Mitgliederversammlung am 07.11.2024 in Dresden einstimmig beschlossen und in der Folge veröffentlicht. Die Forderungen spiegeln die Positionen und Ansichten der Bundesfachschaft Landschaft wider und sollen Entscheidungstragende zum Handeln auffordern und ihnen inhaltliche Orientierung bieten.
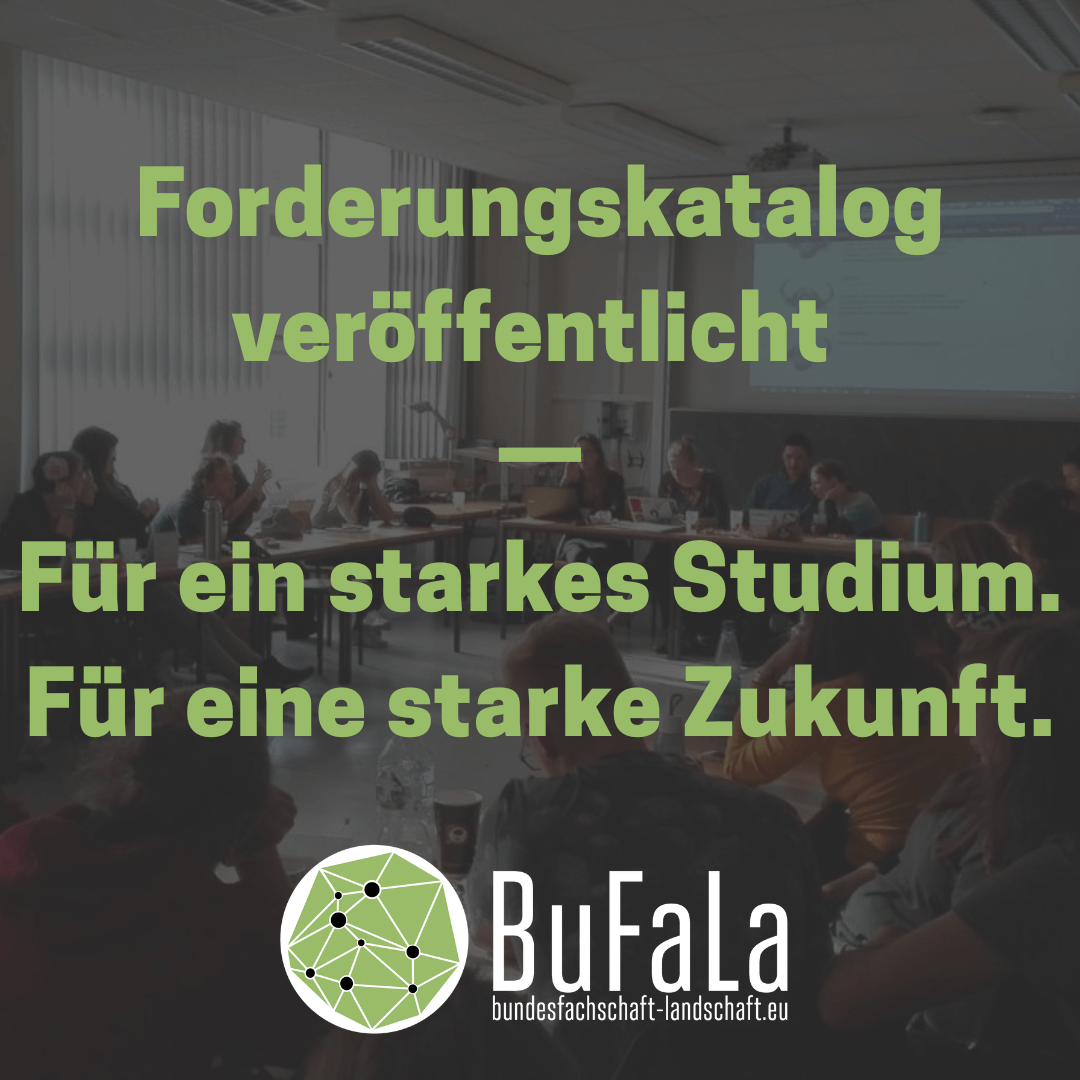
1 Hochschulpolitische Forderungen
1.1 Zugang zu Werkstätten und Arbeitsräumen für Studierende
Forderung: Die Hochschule soll den Studierenden jederzeit zugängliche Werkstätten und Arbeitsräume bereitstellen, die über alle notwendigen Einrichtungsgegenstände verfügen und eine Mindestaufenthaltsqualität für Gruppenarbeiten bieten. Die Studierenden sollen aktiv in die Gestaltung dieser Räume einbezogen werden, um eine bedarfsgerechte Nutzung zu ermöglichen.
Räume mit spezieller Ausstattung können hiervon ausgenommen sein, jedoch sollen auch hier die Nutzungszeiten fair und gleichmäßig verteilt werden. Zusätzlich ist die Bereitstellung kostenfreier Druck- und Plottermöglichkeiten in den Fakultätsgebäuden erforderlich. Diese Geräte sollten jederzeit zugänglich sein, und ein Support für kurzfristige Hilfeleistungen muss eingerichtet werden.
Begründung: Für viele Studierende sind die Werkstätten und Arbeitsräume unerlässlich, um ihre Projektarbeiten und Modellbauaufgaben in hoher Qualität umsetzen zu können. Viele verfügen zuhause nicht über die nötigen Ressourcen oder geeignete Räumlichkeiten, um solche Arbeiten durchführen zu können. Zudem fördern gemeinschaftlich genutzte Arbeitsräume den Austausch und die Vernetzung zwischen den Studierenden über die Semestergrenzen hinaus und tragen so zu einer besseren Lernumgebung bei.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.2 Forderung nach frei verfügbaren Materialien, Werkzeugen und Literatur für Studierende
Forderung: Materialien, Werkzeuge und Literatur, die für das Erfüllen von Studienleistungen erforderlich sind, müssen den Studierenden kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Dies umfasst alle notwendigen Ressourcen wie beispielsweise Sezierbestecke, Modellbaumaterialien sowie die erforderliche Fachliteratur.
Begründung: Wir lehnen versteckte Studiengebühren grundsätzlich ab, da der Studienerfolg unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der Studierenden gewährleistet sein muss. Die verpflichtende Anschaffung solcher Materialien und Werkzeuge stellt für viele Studierende eine finanzielle Belastung dar, die den Zugang zu Bildung und die Chancengleichheit gefährden kann. Daher fordern wir eine Bereitstellung aller essenziellen Ressourcen durch die Hochschule, um allen Studierenden ein gleichberechtigtes Studium zu ermöglichen.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.3 Verfügbarkeit von Software und Hardware
Forderung: Die Hochschule soll allen Studierenden die für die Erfüllung von Studienleistungen notwendige Software kostenfrei zur Verfügung stellen. Sollte die Bereitstellung über Computerarbeitsplätze in den Räumlichkeiten der Hochschule erfolgen, müssen die Zugangszeiten zu diesen Räumen so gestaltet sein, dass alle Studierenden ausreichend Gelegenheit zur Nutzung erhalten.
Begründung: Die Anschaffung von Software und Hardware, die den Anforderungen des Studiums gerecht wird, stellt für viele Studierende eine erhebliche finanzielle Belastung dar und kann zu ungleichen Chancen führen. Darüber hinaus verfügen nicht alle Studierenden über Geräte mit den nötigen technischen Spezifikationen. Durch die Bereitstellung entsprechender Ressourcen durch die Hochschule kann sichergestellt werden, dass alle Studierenden unabhängig von ihrer finanziellen Lage Zugang zu den erforderlichen Arbeitsmitteln haben.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.4 Open-Source-Software als Standard in der Lehre
Forderung: In der Lehre soll bevorzugt freie und quelloffene Software zum Einsatz kommen. Damit sollen Studierende Zugang zu Software erhalten, die keine zusätzlichen finanziellen Belastungen mit sich bringt und langfristige Unabhängigkeit von bestimmten Herstellern und Lizenzen ermöglicht.
Begründung: Der Einsatz proprietärer Software in der Lehre kann wirtschaftliche Abhängigkeiten schaffen, da Absolvent:innen oftmals an bestimmte, kostenpflichtige Programme gewöhnt sind. Dies kann Studierende nach dem Studium finanziell belasten und ihre Flexibilität im Arbeitsmarkt einschränken. Quelloffene Software bietet eine nachhaltige Alternative, die das Problem der Finanzierung im Studium löst, Barrieren für Studierende abbaut und das Bewusstsein für offene, gemeinschaftlich entwickelte Technologien stärkt. Außerdem fördert der Umgang mit Open-Source-Software das technische Verständnis und die Fähigkeit, Software flexibel anzupassen, was für die Zukunft vieler Berufe von Vorteil ist.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.5 Aufwandsausgleich für Gremienarbeit
Forderung: Für die Mitarbeit in etablierten oder gesetzlich vorgesehenen Gremien der Hochschule soll ein Aufwandsausgleich gewährt werden. Dies kann entweder in Form eines Zeitausgleichs erfolgen, indem Semester, in denen Gremienarbeit geleistet wird, nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet werden, oder durch die Zahlung eines finanziellen Ausgleichs.
Begründung: Die aktive Beteiligung von Studierenden in Hochschulgremien ist entscheidend für eine lebendige Hochschuldemokratie und die Mitbestimmung aller Mitgliedergruppen. Da die Mitarbeit in diesen Gremien mit einem erheblichen zeitlichen Aufwand verbunden ist, entsteht für engagierte Studierende oft ein Nachteil im Studium. Ein Ausgleich durch die Nichtanrechnung der Fachsemester oder eine finanzielle Vergütung ist notwendig, um diesen Mehraufwand gerecht zu kompensieren und so das Engagement in der Hochschulpolitik zu fördern und zu honorieren.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.6 Förderung nachhaltiger Mobilität an den Hochschulen
Forderung: Studierenden soll der Zugang zu umweltfreundlicher Mobilität erleichtert werden. Dazu gehören ausreichend dimensionierte und überdachte Fahrradstellplätze an strategisch sinnvollen Standorten, teilweise mit Lademöglichkeiten für E-Bikes, frei zugängliche Reparaturstationen und Luftpumpen sowie die Möglichkeit, (E-)Lastenräder auszuleihen.
Begründung: Die Förderung nachhaltiger Mobilität bietet zahlreiche Vorteile:
- Reduktion des CO₂-Ausstoßes: Die Nutzung von (E-)Fahrrädern trägt dazu bei, den CO₂-Ausstoß zu verringern und leistet somit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.
- Verbesserung der Luftqualität: Der Verzicht auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor reduziert Schadstoffemissionen, was die lokale Luftqualität erhöht und den Umweltschutz fördert.
- Gesundheitsförderung: Der Ausbau von Radinfrastruktur ermutigt Studierende zur Radnutzung, was ihre körperliche Aktivität fördert und somit zu besserer Gesundheit und höherem Wohlbefinden beiträgt.
- Bessere Erreichbarkeit der Hochschule: Durch ausreichend Fahrradstellplätze und Reparaturmöglichkeiten wird die Hochschule einfacher und flexibler zugänglich, besonders für Studierende ohne Auto.
- Vorbildfunktion der Hochschulen: Hochschulen können durch die Förderung nachhaltiger Mobilität ihre Vorbildrolle ausfüllen. Indem sie klimafreundliche Mobilitätsangebote schaffen, sensibilisieren sie Studierende für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen und setzen ein positives Beispiel für die Gesellschaft.
- Flexibilität durch E-Lastenräder: Die Bereitstellung von E-Lastenrädern ermöglicht es Studierenden, ihr Transportmittel flexibel und bequem an verschiedene Bedürfnisse anzupassen.
Insgesamt unterstützt die Förderung nachhaltiger Mobilität an Hochschulen die Bereitstellung eines umweltfreundlichen, gesunden und kostengünstigen Transportangebots für Studierende. Sie stärkt nicht nur das individuelle Wohl, sondern trägt zur langfristigen Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung bei.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.7 Förderung von Doppelabschlussprogrammen
Forderung: Hochschulen sollen vermehrt Doppelabschlussprogramme einrichten, die Studierenden die Möglichkeit bieten, parallel oder in Kombination Abschlüsse in verschiedenen, miteinander verwandten Fachbereichen zu erwerben.
Begründung: Doppelabschlussprogramme fördern das Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Berufsfeldern, insbesondere zwischen planenden und ausführenden Professionen. Oft führen die unterschiedlichen Schwerpunkte und Perspektiven in der Ausbildung zu Kommunikationsproblemen und Missverständnissen in der Praxis. Durch Doppelabschlüsse können Studierende umfassendere Kenntnisse über verschiedene Projektphasen erwerben, was eine ganzheitliche Betrachtung und ein besseres Verständnis von Arbeitsabläufen ermöglicht. Zusätzlich eröffnen Doppelabschlüsse den Studierenden mehr berufliche Flexibilität und erleichtern eine spätere Umorientierung in verwandte Berufsfelder.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.8 Verstärkung des Praxisbezugs im Studium
Forderung: Der Praxisbezug im Studium soll durch verschiedene Maßnahmen gestärkt und institutionell verankert werden. Dies kann durch den Einsatz von Lehrenden aus der beruflichen Praxis, praxisnahe Projekte mit direktem Bezug zu theoretischen Inhalten oder durch andere geeignete Formate geschehen. Diese Maßnahmen sollten verbindlich in den Studienordnungen festgeschrieben werden, um eine nachhaltige Integration des Praxisbezugs sicherzustellen.
Begründung: Die Nachfrage nach praxisnah ausgebildeten Absolvent:innen ist hoch, und ein intensiver Praxisbezug bereits während des Studiums bietet zahlreiche Vorteile. Studierende können frühzeitig wertvolle berufliche Erfahrungen sammeln, Netzwerke mit zukünftigen Arbeitgeber:innen und Partner:innen aufbauen und wesentliche Soft Skills entwickeln. Darüber hinaus fördert die praxisorientierte Anwendung theoretischer Lehrinhalte das Verständnis und die Verbindung von akademischem Wissen mit realen Herausforderungen und Anforderungen der Berufswelt. Eine institutionelle Verankerung dieses Ansatzes stellt sicher, dass praxisrelevante Kompetenzen langfristig ein fester Bestandteil der Hochschulausbildung bleiben.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.9 Inklusion und Chancengleichheit
Forderung:
- Gender-Gerechtigkeit:Anerkennung des dgti-Ausweises an Hochschulen (siehe dgti.org)
- Barrierefreiheit:Berücksichtigung der Einschränkungen verschiedener Gruppen (z. B. Mobilitätseinschränkungen, Seheinschränkungen, Sprachbarrieren, chronische Krankheiten etc.). Der Einbezug dieser Aspekte soll bereits in der Planung aller Strukturen, Exkursionen, Projektangebote usw. gewährleistet sein.
Begründung: Die Forderung nach Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion an Hochschulen basiert auf dem Grundsatz, dass Bildung und Hochschulzugang für alle Menschen gerecht und diskriminierungsfrei gestaltet sein sollten. Nur durch die Anerkennung und Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Studierenden und Beschäftigten – unabhängig von Geschlecht, Identität oder Beeinträchtigung – kann eine Hochschule ihren Anspruch auf Chancengleichheit und soziale Verantwortung erfüllen.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.10 Schaffung von Weisungsbefugnissen gegenüber Professor:innen
Forderung: Professor:innen, deren mangelnde Lehrqualität das Erreichen der Qualifikationsziele der Studierenden erheblich erschwert, sollen zur Rechenschaft gezogen werden können.
Begründung: Mangelhafte Lehre gefährdet das Erreichen der Qualifikationsziele der Studierenden und beeinträchtigt ihre beruflichen Perspektiven. Die Möglichkeit, Professor:innen in solchen Fällen zur Rechenschaft zu ziehen, stellt sicher, dass die Qualität der Lehre auf einem hohen Niveau bleibt. Sie stärkt das Vertrauen der Studierenden in die Hochschule und bietet Anreize zur kontinuierlichen Verbesserung der Lehrmethoden. Diese Maßnahme unterstützt langfristig den Erfolg der Studierenden und die Reputation der Hochschule. Es sei betont, dass die Freiheit von Lehre und Forschung eine grundlegende Säule des akademischen Betriebs darstellt. Die Forderung richtet sich nicht auf eine Einschränkung dieser Freiheit, sondern auf die Sicherstellung einer hohen Lehrqualität und Verantwortlichkeit der Professor:innen.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.11 Konsequenzen aus Evaluationen müssen spürbar sein
Forderung: Kritik an der Lehrqualität soll den Lehrenden konstruktiv und direkt herangetragen werden. Diese Rückmeldungen sollen im Rahmen einer Zielvereinbarung festgehalten werden. Der Erfolg der Umsetzung dieser Verbesserungsvorschläge muss regelmäßig durch Evaluierungen überprüft werden, und die Entwicklung soll kontinuierlich weiter gefördert und unterstützt werden.
Begründung: Um die Qualität der Lehre nicht nur zu überprüfen, sondern auch aktiv zu sichern und zu steigern, ist es notwendig, Wege zu finden, die Lehrenden zur Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen zu motivieren. Durch regelmäßige Evaluationen und die Festlegung konkreter Zielvereinbarungen können die Fortschritte transparent gemacht und die Verantwortlichkeit der Lehrenden gestärkt werden. Dies trägt dazu bei, die Lehrqualität auf einem hohen Niveau zu halten und stetig zu verbessern, was letztlich dem Erfolg der Studierenden zugutekommt.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.12 Stellungnahme zur aktuellen Praxis der Krankmeldung zu Prüfungen
Forderung: Es soll eine Stellungnahme zum vorgesehenen Formblatt des SMWKT, welches unter anderem das genaue Krankheitsbild enthalten soll geschrieben und eine Änderung gefordert werden. Wir möchten uns an dieser Stelleden Forderungen der Konferenz Sächsischer Studierendenschaften (KSS) anschließen.
Begründung der Position: (https://www.kss-sachsen.de/pruefungsabmeldungen):
Nach intensiver Recherche im Vorfeld der letzten Anhörung zur Novellierung des Sächsischen Hochschulgesetzes hat sich herausgestellt, dass in keinem Bundesland die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) zur Prüfungsabmeldung gesetzlich zwingend hinreichend ist. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus der einschlägigen Rechtsprechung, die den Prüfungsausschuss berechtigt, die Prüfungsunfähigkeit des/der Student*in festzustellen. Auch die sächsische Datenschutzbeauftragte hat wiederholt entsprechende Aussagen (etwa in ihrem 16. Tätigkeitsbericht unter Punkt 13.1) getätigt.
In den letzten Wochen hat sich gezeigt, dass mehrere sächsische Hochschulen von einer recht liberalen Praxis abweichen und von nun an von ihren Studierenden Atteste mit Symptomen oder gar Krankheitsbeschreibungen einfordern. Es ist insofern erwartbar, dass bei gleichbleibender Rechtslage zeitnah auch jene Hochschulen, welche aktuell noch liberal handeln, nachziehen.
In Anbetracht der politischen Verhältnisse in Sachsen ist nicht erwartbar, dass man einen Weg geht, der in noch keinem anderen dt. Bundesland gegangen wurde. Nach entsprechender Recherche hat sich jedoch gezeigt, dass die Länder Nordrhein-Westfalen und Thüringen Regelungen i.S. des Antragstextes in ihren Gesetzen haben, welche auch offensichtlich mit geltendem Recht vereinbar sind.
Diese Regelungen und damit auch der hier vorliegende Antrag läuft darauf hinaus, dass die Ärztin ein Formular auszufüllen hat, welches die Prüfungsunfähigkeit bestätigt, vermutlich differenziert nach Prüfungsart (schriftlich, mündlich, (sport-)praktisch, Hausarbeit). Als gutes Beispiel kann die Vorlage der Universität Frankfurt am Main angesehen werden. Die Forderung nach der Kostenübernahme für ggf. entstehende Gebühren durch die Hochschule ergibt sich aus der sozialen Situation unserer Kommiliton*innen.
Der zweite Teil des Gesetzesvorschlages ist als ein Auffangparagraph zu verstehen, der dem ‘Argument’ der sog. Dr. Holiday-Ärzt*innen entgegenwirken soll.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.13 Vertretung der Studierendenschaft in relevanten Gremien, die das Studium oder die Inhalte des Studiums betreffen
Forderung: Die Studierendenschaft soll in allen relevanten Gremien, die das Studium oder die Inhalte des Studiums betreffen, angemessen vertreten sein. Die Studierenden müssen in die Entscheidungsprozesse einbezogen und ihre Interessen gehört werden.
Begründung: Die Belange der Studierenden müssen in allen Gremien, die sie betreffen, durch die Studierendenschaft vertreten werden. Mitspracherechte sind ein grundlegendes Element jeder demokratischen Struktur. Durch die aktive Teilnahme und Mitgestaltung in diesen Gremien können die Studierenden ihre Perspektiven einbringen und Einfluss auf Entscheidungen nehmen, die ihr Studium betreffen. Dies stärkt nicht nur die akademische Gemeinschaft, sondern fördert auch die Entwicklung einer transparenten und inklusiven Hochschulkultur.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.14 Fort- und Weiterbildung erleichtern
Forderung: Es sollen Möglichkeiten geschaffen werden, auch Module aus anderen Disziplinen zusätzlich zu den eigenen Studieninhalten auf freiwilliger Basis zu belegen und sich diese anerkennen zu lassen. Dasselbe soll für Module gelten, die während eines Auslandssemesters absolviert wurden. Diese Leistungen sollen mindestens als Zusatzleistung im Zeugnis vermerkt werden, idealerweise jedoch durch die Anrechnung entsprechender Credit Points, orientiert an denen ähnlicher Module.
Begründung: Da sowohl Studiengänge als auch das Berufsleben zunehmend durch interdisziplinäre Zusammenarbeit geprägt sind, sollte die Möglichkeit, auch Module aus anderen Disziplinen zu belegen, erleichtert werden. Dies fördert ein weiterführendes Verständnis von Arbeitsabläufen und trägt zur besseren Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen bei. Durch die Anerkennung und Anrechnung dieser Leistungen wird den Studierenden ermöglicht, ihr Wissen zu erweitern und flexibel auf die Anforderungen des späteren Berufslebens zu reagieren.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
1.15 Angemessene Raumgröße für studentische Vertretungen
Forderung: Studentischen Vertretungen sollen Räumlichkeiten in einer angemessenen Anzahl und Größe zur Verfügung gestellt werden. Diese sollen sich mindestens an der Anzahl der gesetzlich vorgesehenen Mitglieder orientieren. Im Regelfall soll pro 35 Studierende, die vertreten werden, ein Sitzplatz mit Tisch bereitgestellt werden.
Begründung: Die Qualität der studentischen Interessenvertretung hängt maßgeblich von der Ausstattung der jeweiligen Vertretung ab. Ein geeigneter Raum ist entscheidend, um sowohl Einzelarbeit als auch regelmäßige Zusammenkünfte effektiv durchführen zu können. Nur durch eine ausreichende und gut ausgestattete Infrastruktur können die Mitglieder der Vertretung ihre Aufgaben in der erforderlichen Qualität und mit dem nötigen Engagement wahrnehmen.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
2 Fachbezogene Forderungen
2.1 Dachnutzungspflicht
Forderung: Dächer sollen als bereits vorhandene Flächen für unterschiedlichste Nutzungen zur Verfügung gestellt werden und ihre Nutzung soll verpflichtend erfolgen. Mindestens soll dies durch eine extensive Dachbegrünung oder durch die Kombination von Grünflächen und Solarenergie erreicht werden. Zusätzlich kann auch eine intensive Dachbegrünung in Verbindung mit Nutzungsmöglichkeiten für Menschen in Betracht gezogen werden.
Begründung: Angesichts des Klimawandels ist es zwingend erforderlich, Städte kühl zu halten und die Emissionen signifikant zu reduzieren. Eine verpflichtende Nutzung von Dachflächen für Begrünung und/oder zur Bereitstellung von Flächen für die Stromerzeugung kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Dies fördert nicht nur das Klima, sondern bietet auch Potenziale für die Verbesserung der Lebensqualität und die Schaffung nachhaltiger städtischer Räume.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
2.2 Vorrang des Schutzes bestehender Natur- und Grünflächen gegenüber der Ausweisung von Neubaugebieten
Forderung: Der Schutz bestehender Natur- und Grünflächen soll gegenüber der Ausweisung von Neubaugebieten Vorrang haben. Der Erhalt dieser Flächen ist zu priorisieren und nach Möglichkeit sollen Nachnutzungskonzepte für bereits versiegelte Flächen entwickelt werden. Alle nicht mehr benötigten versiegelten Flächen sollen entsiegelt werden.
Begründung: Angesichts des Klimawandels ist der Erhalt von Natur- und Grünflächen unerlässlich. Diese Flächen tragen zur Regulierung des Klimas bei, fördern die Biodiversität und verbessern die Lebensqualität in städtischen Gebieten. Die Versiegelung von Flächen durch Neubauten stellt eine erhebliche Belastung dar. Daher sollten bestehende Grünflächen als wertvolle Ressourcen für die Umwelt und das Wohl der Stadtbewohner:innen geschützt werden. Anstatt neue Neubaugebiete auszuweisen, sollte die Entwicklung von Nachnutzungskonzepten im Vordergrund stehen, um eine nachhaltige und umweltschonende Stadtentwicklung zu fördern.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
2.3 Pflege sollte Vorrang vor Neubau haben
Forderung: Die Pflege bestehender Freiräume und Infrastruktur soll Vorrang vor der Umgestaltung oder dem Neubau von Flächen haben. Bestehende Ressourcen sollen gezielt erhalten und gepflegt werden, anstatt diese vorschnell zu verändern oder neu zu gestalten.
Begründung: Es wird zunehmend beobachtet, dass Freiräume umgestaltet werden, anstatt diese in ihrem aktuellen Zustand nachhaltig zu pflegen. Durch eine gezielte Pflege können bestehende Grünflächen und Infrastruktur langfristig erhalten und ihre positiven ökologischen, sozialen und ästhetischen Funktionen bewahrt werden. Die Ressourcenschonung und die Minimierung von Eingriffen in die Natur sind dabei wesentliche Ziele, die eine nachhaltige Stadt- und Landschaftsgestaltung fördern.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
3 Berufsständische Forderungen
3.1 Zugang zu Architektenkammern deutschlandweit vereinheitlichen
Forderung: Der Zugang zu den Architektenkammern soll deutschlandweit vereinheitlicht werden, um allen Absolvent:innen die gleichen Chancen auf die Mitgliedschaft zu bieten, unabhängig vom Bundesland ihres Studienorts.
Begründung: Der Zugang zu den Architektenkammern variiert derzeit je nach Bundesland, was bedeutet, dass Absolvent:innen je nach Studienort unterschiedlich leicht oder schwer in die Kammern aufgenommen werden. Diese Ungleichbehandlung führt zu Benachteiligungen und schafft ein ungleiches Wettbewerbsumfeld für Architekt:innen. Eine bundesweit einheitliche Regelung würde Chancengleichheit gewährleisten und eine gerechtere Ausgangslage für alle Absolvent:innen schaffen.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
3.2 Junior-Mitgliedschaft in allen Architektenkammern für Studierende
Forderung: Die Möglichkeit einer Junior-Mitgliedschaft in allen Architektenkammern soll für Studierende eingeführt oder standardisiert werden, sodass Absolvent:innen in jedem Bundesland von dieser Option profitieren können.
Begründung: Die Juniormitgliedschaft in den Architektenkammern ist derzeit nicht in allen Bundesländern verfügbar, was zu Benachteiligungen führen kann, je nachdem, in welchem Bundesland Absolvent:innen nach ihrem Studium tätig werden. Eine Juniormitgliedschaft erleichtert den Zugang zur Kammer und bietet Absolvent:innen eine wertvolle Orientierungshilfe, um zu entscheiden, ob sie die volle Mitgliedschaft anstreben möchten. Sie schafft einen niedrigschwelligen Einstieg und unterstützt die berufliche Integration in die Kammer.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
3.3 Sichtbarkeit & Aufklärung über Aufgaben/Funktion der Kammern in den Hochschulen (KEINE WERBUNG)
Forderung: Studierende, deren Abschluss grundsätzlich zur Mitgliedschaft in der Architektenkammer führen kann, sollen frühzeitig im Studium über die Bedingungen und Aspekte der Kammermitgliedschaft informiert werden. Diese Aufklärung sollte ohne Werbecharakter erfolgen und sich auf die Aufgaben und Funktionen der Kammern konzentrieren.
Begründung: Das Thema Kammermitgliedschaft wird im Studienverlauf bislang nur selten oder gar nicht thematisiert. Studierende, insbesondere aus den Fachrichtungen wie Landschaftsarchitektur, deren berufliche Tätigkeit eng mit einer Kammermitgliedschaft verbunden ist, erfahren oft erst sehr spät von den Bedingungen und Anforderungen. Eine frühzeitige Aufklärung ermöglicht es den Studierenden, sich rechtzeitig mit der Thematik auseinanderzusetzen, und unterstützt sie bei der späteren beruflichen Orientierung. Dies kann dazu beitragen, die Berufsfindung zu erleichtern und Unsicherheiten über den Kammerbeitritt zu verringern.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024
3.4 Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Forderung: Die interdisziplinäre Zusammenarbeit soll in der Lehre und in praxisorientierten Projekten verstärkt gefördert werden. Studierende verschiedener Fachrichtungen sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Perspektiven und Kompetenzen im Rahmen gemeinsamer Projekte auszutauschen und zu erweitern.
Begründung: Im Berufsalltag wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit immer wichtiger, da viele Aufgaben zunehmend berufsübergreifend gelöst werden müssen. Durch die enge Kooperation von Fachleuten aus unterschiedlichen Disziplinen können innovative Lösungen entwickelt und neue Ansätze erarbeitet werden. Dabei profitieren die Studierenden von der Expertise und dem Wissen anderer Berufsfelder und können ihr eigenes Wissen in einen größeren Kontext einbringen. Dies fördert nicht nur die persönliche Weiterentwicklung, sondern bereitet die Studierenden auch besser auf die Herausforderungen der Berufspraxis vor.
Datum des Beschlusses durch die Mitgliederversammlung: 07.11.2024
Datum der letzten Änderung: 07.11.2024